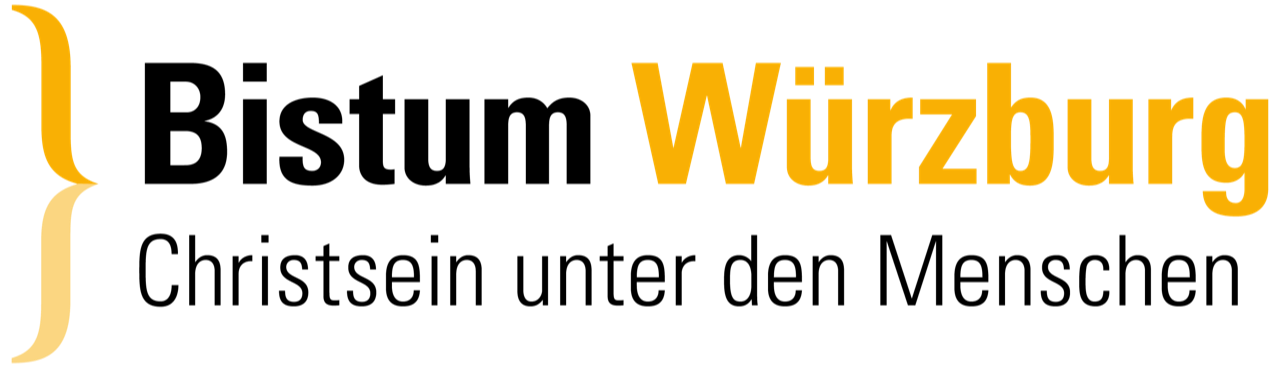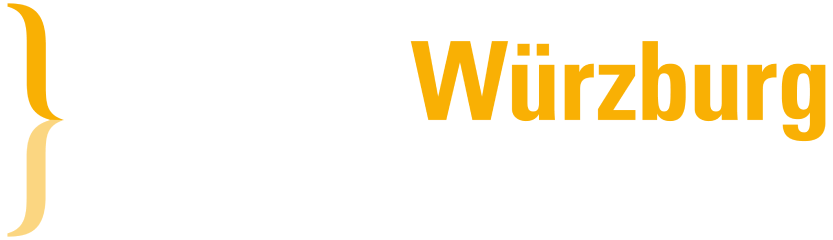So beginnt der Beitrag auf den Seiten 4 und 5, der sich damit auseinandersetzt, dass die Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts bislang im Religionsunterricht so gut wie nicht vorkam und damit bei vielen das Wissen fehlt, dass dieses Kirchenbild noch recht jung ist und welche Wurzeln es hat. Daran mag es auch liegen, dass sich dieses Kirchenbild so hartnäckig in vielen Köpfen und Herzen festgesetzt hat. Nun ist natürlich jeder und jede dem Kirchenbild verhaftet, mit dem er oder sie aufgewachsen ist. Und selbst reformorientierte Zeitgenossen werden sich gelegentlich dabei ertappen, selbst in Denk- und Handlungsmuster zu verfallen, die sie überwinden wollen.
Ein Blick in die Kirchengeschichte aber zeigt, wie oft und teilweise massiv sich die Kirche immer wieder verändert hat – leider nicht immer nur zum Besseren. So gehört es auch zu dieser Wandlungsfähigkeit, dass sie Fehlentwicklungen und Irrwege – oft spät und auf schmerzhafte Weise – identifiziert und Konsequenzen gezogen hat. Der Blick in die Geschichte kann auch lehren, dass manches, das man am eigenen Kirchenbild für konstitutiv hält, letztendlich zeitbedingt und wandel- oder verzichtbar ist.
Diese Wandelbarkeit betrifft auch die Verkündigung, denn Kirche ist kein Selbstzweck, sie hat eine Mission „Wir müssen das Evangelium neu buchstabieren, damit dieses auch den Menschen des 21. Jahrhunderts etwas zu sagen hat“, hat es Thomas von Mitschke-Collande im Interview auf Seite 7 auf den Punkt gebracht und fährt fort: „Die jüngste Studie zeigt nämlich auch, dass christliche Glaubensaussagen und Wertvorstellungen den Menschen von heute für ihr Leben nicht mehr wichtig sind. Sie können damit nichts anfangen.“ Bleibt die Gewissensfrage – gleichermaßen für jeden Einzelnen und die kirchliche Gemeinschaft: Habe ich/haben wir den Menschen etwas zu sagen und zu geben?
Wolfgang Bullin