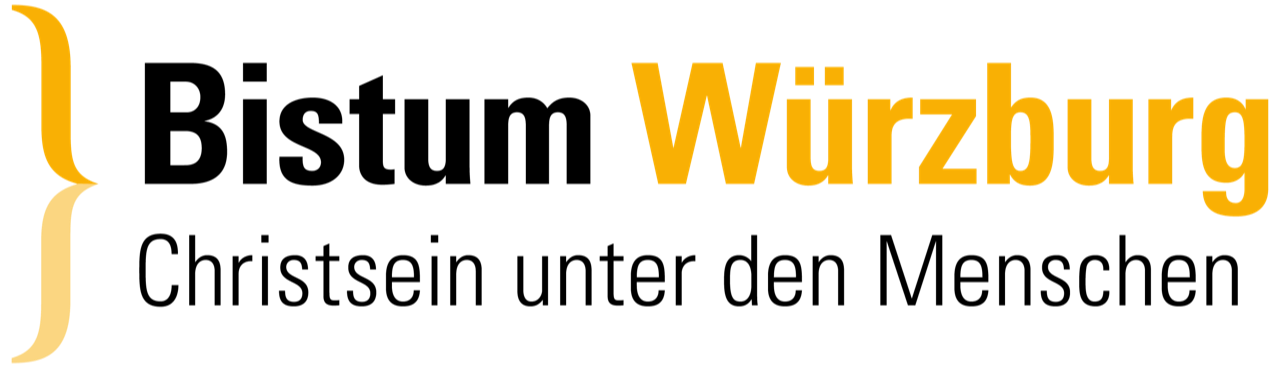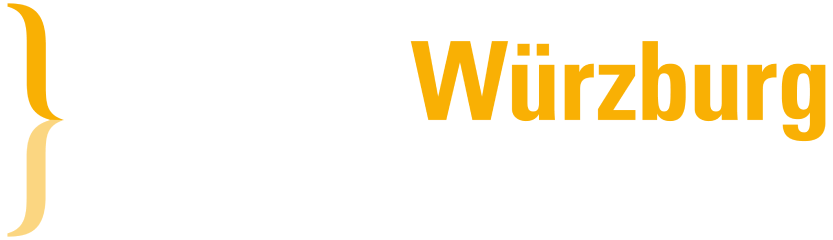Einmal waren wir zu siebt, bei klirrender Kälte führte der „Guide“ im Januar 1977. Wärmer war es im April 2003, als Bruder Franziskus von der Fraternité Monastique de Jérusalem uns empfing, um mit zwei Besuchern über Gott und die Welt zu reden, und die Begegnung im abgetrennten Klosterbereich mit einem gemeinsamen Gebet abschloss. Nicht nur der Zugang ist neu, auch das religiöse Leben auf dem Klosterberg hat spürbar Rückenwind. 1966 kehrten vier Benediktinermönche auf den Mont Saint-Michel zurück. Mit der Fraternité Monastique de Jérusalem, seit Juni 2001 mit vier Brüdern und sieben Schwestern auf dem Heiligen Berg ansässig, hat sich das religiöse Leben deutlich intensiviert: Außer der Mittagsmesse um 12.30 Uhr in der Abteikirche gibt es Angebote für Gespräche und mehrtägige Aufenthalte in den für Männer und Frauen getrennten Bereichen der Abtei. Priorbruder François-Marie: „Dort zu sein, wo Menschen nach dem Sinn des Lebens suchen, das ist unsere Berufung. Das ist ein Ort, der für klösterliches Leben geschaffen ist und der unserer Weise, es zu leben, entspricht“. Statt sieben Gebeten pro Tag (wie bei den Benediktinern) gibt es bei der Bruderschaft von Jerusalem nur drei Gebetszeiten, damit Brüder und Schwestern mindestens halbtags auch „irdischen“ Tätigkeiten nachgehen können, als Ärztin, Architektin oder Bäcker, von deren Gehältern die Gemeinschaft lebt.
Besuche bei Wind und Wetter
Ebenfalls steigende Tendenz gibt es bei den Wallfahrten zum Mont Saint-Michel, denn auf dem Weg vom Pilgerzentrum in Ardevon bei Ebbe durch die schlammige Bucht lässt sich am ehesten erahnen, wie es den Pilgern erging, die Jahrhunderte hindurch aus allen Teilen Europas auf den Berg des Erzengels zuwanderten: Bei Wind und Wetter, durch die sables mouvants, den gefährlichen Treibsand und die noch gefährlichere Flut, die „schneller als ein Pferd im Galopp“ und bis zu 15 Meter hoch kommen kann. Der neue Zugang in der Bucht von Saint-Malo hat eine neue Sichtweise zur Folge: Irgendwie lässt man das Festland und die Welt besser und leichter hinter sich, das Ziel im Wattenmeer nicht nur vor dem geistigen Auge. Von den Parkplätzen geht es aus dem Auto und in die gasgetriebenen Shuttle-Busse, alternativ in pferdegezogene Kutschen. Hinaus, in Richtung Meer, da wo zwischen 1879 und 2012 ein 1,6 Kilometer langer Damm den Klosterberg mit dem Festland verband und das Spiel der Gezeiten verhinderte, so dass die Versandung der Bucht drohte. Nach einer über zehnjährigen Renaturierung wird seit 2015 der Mont Saint-Michel wieder regelmäßig zur Insel. Am Ende einer neuen, wasserdurchlässigen Brücken-Konstruktion entlässt der Shuttlebusfahrer von „Le Passeur“ die Mont-Besucher und per pedes geht es immer trockenen Fußes weiter.
Dabei ist man immer wieder beeindruckt von dem 78 Meter hohen Granitfelsen und den darauf in vielen Jahrhunderten errichteten Bauten. Im Jahre 708, so berichtet die Legende, erschien der Erzengel Michael dem Bischof Aubert von der benachbarten Stadt Avranches. Er forderte ihn auf, auf einer der drei Eilande, die ein Erdbeben in der Bucht hinterlassen hatte, ein Bethaus zu errichten. Da der Bischof zögert, muss ihm der Erzengel drei Mal erscheinen, die Reste der karolingischen Kirche von 788 sind Teil von Notre-Dame-sous-Terre, einer der unteren Kapellen.
Ein Schutz-Bollwerk
Wer durch das Eingangstor Port de l’Avancée eingetreten ist, befindet sich innerhalb der alten Befestigungsmauer, die den Mont Saint-Michel auch in den Zeiten des hundertjährigen Krieges zwischen Frankreich und England im Mittelalter schützte. Eine Gasse führt bergan, und an ihr liegen die Versuchungen eines Wallfahrts- und Touristenortes: Geschäfte mit Waren aller Art, Souvenirs, Postkarten und zahlreiche Lokale. So mancher Besucher gibt sich hier dem Genuss von Fleisch und Fisch aus der Bucht hin. Rund 600 Stufen liegen auch an diesem sommerlich warmen Tage vor uns, bis wir, vorbei an der Pfarrkirche, endlich die finale, steile Treppe hinauf zur Abteikirche erreichen und dann, nach Entrichtung des Eintritts an die „Monuments historiques“, auf der ersten Terrasse stehen und mit dem Blick auf den Grenzfluss Couesnon mit der jahrhundertealten Frage konfrontiert werden: Wie kam der Mont Saint-Michel in die Normandie? Ein altes Volkslied erklärt, dass der „verrückte Couesnon“ seinen Verlauf verändert hat und damit den Klosterberg in die Normandie gesetzt hat. Die Reiseführer, egal ob in französischer oder deutscher Sprache, sind da toleranter: Sie behandeln das Monument meist in beiden regionalen Ausgaben, bei über drei MiIlionen Besuchern pro Jahr eine weise Entscheidung.
Anstrengende Erkundung
Aber nur rund 600000 Menschen schaffen es jährlich bis zur alten Abtei und Gänge und Krypten zu durchschreiten. Denn vor dem Bau der romanischen Abteikirche galt es, durch zahlreiche Krypten eine Basis zu schaffen, auf der eine kreuzförmige Basilika aufgerichtet werden konnte. Besonders massiv mussten die Fundamente für die vier Säulen der Vierung auf dem Felsen sein, denn der Vierungsturm hat über 140 Meter, auf ihm eine 7,50 Meter hohe und 400 Kilogramm schwere goldene Statue des Erzengels Michael. Auf einer zweiten Terrasse entdeckt man im Boden die Zeichen der Steinmetze und geht der Blick hinüber auf die unbewohnte, kleine Nachbarinsel Tombelaine. Die zwei anderen Eilande von 708 liegen durch die Polder inzwischen im „Festland“. Auch in ihrer um drei Joche verkürzten Form beeindruckt die Abteikirche. Die Brandspuren an den Wänden des Hauptschiffs erinnern daran, dass der Mont Saint-Michel dreizehn Mal abgebrannt ist, zwölf Mal durch Blitzschlag, einmal, weil Sträflinge Feuer gelegt hatten. Im Dortoir, dem ehemaligen Schlafsaal der Mönche, ist der Buch- und Kartenladen untergekommen, gleich daneben der unbestreitbare Höhepunkt des Klosterberges: Der „Cloître“, der Kreuzgang im obersten Stockwerk des „Merveille“ mit seinen filigranen Säulen und dem Holzgewölbe, wohl aus Gewichtsgründen. Daneben der Speisesaal der Mönche mit seinen besonders geformten Fensterbuchten für eine perfekte Beleuchtung des Refektoriums. Wieder gilt es, Treppen und Gänge zu nutzen, um alle drei Etagen des Süd-Baues zu entdecken: Unter dem Kreuzgang und Speisesaal. Im Rittersaal war das Skriptorium der Mönche untergebracht. Die Manuskripte, die dort entstanden, können in einem Museum im 20 Kilometer entfernten Avranches besichtigt werden. Auch die Geschichte des Berges und die Legende von Bischof Aubert werden dokumentiert. Die älteste erhaltene Darstellung ist die „revelatio ecclesiae sancti michaelis“, zwischen 851 und 855 entstanden. Sie erzählt die Legende von Bischof Aubert, der 708 dreimal zum Bau der ersten Kirche auf dem Felsen im Wattenmeer aufgefordert werden musste.
Der Weg um den Granitfelsen führt in die Krypta der zehn Dicken Pfeiler, welche den gotischen Chor tragen, in die Kapelle Saint-Martin und schließlich in einen Bereich, den einst die Insassen der Strafanstalt Mont Saint-Michel besonders schätzten: Dort wo ein großes hölzernes Rad für die Schrägaufzüge steht, denn immer galt es, Baumaterialien, Einrichtungsgegenstände und Lebensmittel auf den Berg zu bringen. Gefangene arbeiteten gerne am und im Rad, denn es war der einzige Ort, an dem es den Blick ins Freie und frische Meeresluft gab.
Wege-Wirrwarr
Immer weiter geht es durch Räume und Kapellen und immer wieder fragt sich der Besucher, auf welcher Seite des Berges er wohl gerade ist. Mehrere Wendeltreppen bringen ihn an den Fuß des dreistöckigen Merveille-Gebäudes aus dem 13. Jahrhundert, das deutlich macht, welche Infrastruktur nötig war, um die Massen der mittelalterlichen Pilger unterzubringen und zu versorgen.
Im Garten am Fuße des hoch aufragenden Gebäudes angekommen, sind wir froh, wieder frische Luft zu atmen. Für den Weg hinunter wählen wir die weniger genutzte Alternative. Dieser Weg auf der Außenmauer gibt den Blick auf die Bucht frei. Wir sehen mehrere Pilgergruppen, die mit ihren Führern unterwegs sind zum „Festland“, wobei die Begleitung durch einen erfahrenen Guide angesichts von Treibsand und einem Tidenhub unbedingt erforderlich ist. Fast unten angekommen, gönnen wir uns noch eine Rast bei einem Kaffee auf einer Terrasse, mit Blick auf das „Festland“.
Wolfgang O. Hugo