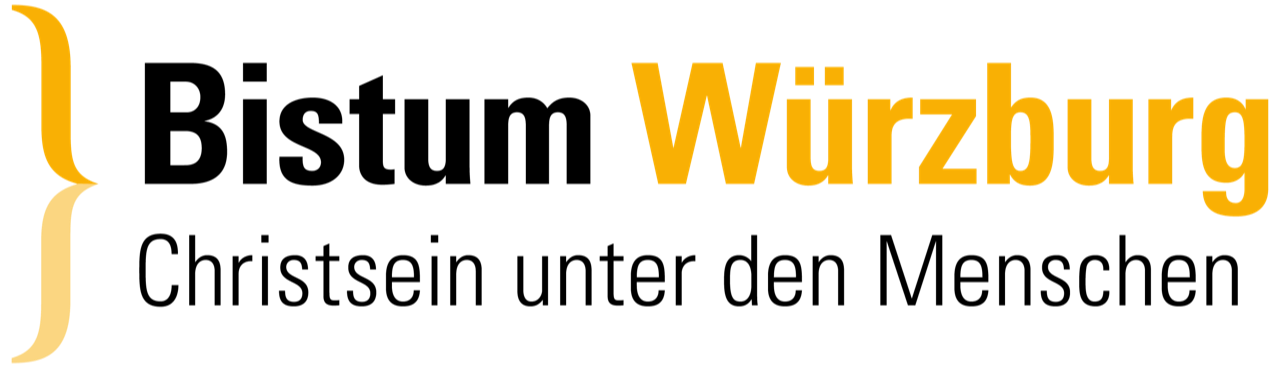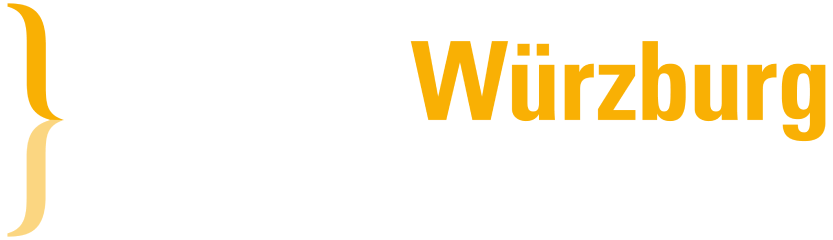Glöckchen und Schätzchen
Nach dem Krieg hatte der weit über die Stadt bekannte Vergoldermeister Theodor Spiegel seinen Betrieb dorthin verlagert. 1992 übernahm Bernhard Schmitt die Werkstatt von seinem Lehrherr Rudolf Hofmann. Bereits seit 1970 aber waren diese beiden Räume – im Schatten des barocken Bischofspalais – für den gebürtigen Thüngersheimer sein „zweites Wohnzimmer“. Dort habe er sich wohlgefühlt, Kunden empfangen, mittags Kaffee getrunken und Brotzeit gemacht. „Natürlich auch feste gearbeitet.“
Zum Ende des Jahres schließt der 72-Jährige, gelernter Vergoldermeister und Fassmaler, Malermeister und Restaurator im Handwerk, für immer seine Werkstatt. Noch ein letzter Besuch. Öffnet man die Türe nur einen Spalt, ertönen drei Glöckchen. Der helle „Tante-Emma-Laden-Klang“ versetzt Besucher sogleich in die sprichwörtlich „gute, alte Zeit“. Zwei Stufen führen in den nur mäßig beleuchteten ersten Raum, Schmitts Büro. Karg möbliert mit Schreibtisch, zwei Stühlen, Computer und Telefon, ist dies die kleine Schaltzentrale des Einmann-Betriebs. Um diesem nüchternen Eingangsbereich ein wenig Flair und Gemütlichkeit zu verleihen, hatte der passionierte Sammler von Ritterburgen und altem Weihnachtsschmuck, vor Jahren Schauvitrinen für seine „Schätzchen“ aufgestellt. „Die Ritterburgen beispielsweise, habe ich auf Flohmärkten im Osten erworben“, erläutert er. Zu welchem Preis? Da schweigt das „Kind im Manne“.
Begeisterung
Seine Burgen mit ihren realistisch konstruierten Zugbrücken und Wehrgängen, hat der Thüngersheimer größtenteils mit kunstvoll bemalten Elastolin-Figürchen – ob in Rüstung oder im bunten Landsknechts-Outfit – bestückt. „Schau mal, die Kanonen und Mörser, die sehen doch wie echt aus …?“ An Begeisterungsfähigkeit mangelt es dem Sammler nicht.
Nach Schmitts kleinem Privatmuseum voller „Kinderträume“, geht es in seine Restaurierungswerkstatt. Dort hat sich der Vergolder in all den Jahren ganz bewusst mit den Kunden zum Gespräch getroffen und gemeinsam die eingelieferten „Sorgenkinder“ begutachtet, Schäden diagnostiziert und Lösungen besprochen. Die Kunden sollten in seiner Werkstatt gleich nachhaken können, was er mit ihren Kostbarkeiten vorhabe, betont Schmitt.
Was bei Schreinern die Holzspäne auf dem Boden, sind beim Vergoldermeister Partikel aus 24-karätigem Blattgold – hauchdünne Reste von Goldfolien in einer Stärke von 0,000125 Millimetern. Und von diesem edlen Material findet sich noch einiges in den Ritzen des Betonbodens. Doch sich zu bücken und es aufzusammeln, lohne die Mühe nicht, „zu dünn und entsprechend leicht ist Blattgold“, sagt der Meister.
Auch hoffnungslose Fälle
An Anschauungsbeispielen für seine Vergoldungs- oder auch Restaurierungskunst mangelt es in der Werkstatt nicht: An den Wänden blicken in Öl gemalte Heilige aus vergoldeten Stuckrahmen. Bis vor kurzem stand auf dem Werktisch noch die ein oder andere Heiligenskulptur. Alles wartete auf Schmitts behutsame und individuelle Sonderbehandlungen: reinigen, ergänzen, vergolden, farblich neu fassen. Kunden, unter ihnen zahlreiche Privatleute, aber auch so manche Geistliche und Vertreter von Kirchenstiftungen und Pfarreien, legten in all den Jahren größten Wert auf Schmitts handwerkliches Können. Denn der Name seiner Werkstatt „Theodor Spiegel“ – unter diesem Namen firmierte er über 50 Jahre lang – hat nie etwas vom alten Glanz verloren.
Ob er auch mal einen Auftrag ablehnen musste? „Nie, gerade die hoffnungslosesten Fälle waren für mich Ansporn.“ Die Kunden hat es gefreut. „Für sie waren das alles in der Regel liebgewonnene Familienschätze, von denen man sich nicht trennen wollte.“ Laut Schmitt gebe es kaum noch Kollegen, die das Vergolder-Handwerk von der Pike auf erlernt haben. Seit Jahren schon stehe der Lehrberuf auf der „roten Liste“ aussterbender Berufe. „Obwohl ein Haufen an Arbeit da ist“, gebe es kaum Nachwuchs.
Zu neuem Leben erweckt
Tausende von Gegenständen – die meisten aus kirchlichem Umkreis – hat Schmitt in dem halben Jahrhundert wieder zu neuem Leben erweckt. So hat er beispielsweise dafür gesorgt, dass bei Skulpturen Verlorengegangenes, beispielsweise bei einem Jesuskind das segnende Händchen, neu modelliert und farblich angeglichen wurde. „So hatte dann alles wieder seinen Sinn erhalten.“
Gerne erinnert sich der Thüngersheimer an seine Anfänge als Lehrbub bei Rudolf Hofmann. An dem frühmittelalterlichen Radleuchter der Stiftskirche des Klosters Großcomburg oberhalb von Schwäbisch Hall, habe er seine ersten restauratorischen Erfahrungen gesammelt. Radleuchter wie dieser – nahezu fünf Meter im Durchmesser – dienten nicht nur der Beleuchtung, sondern stellten mit ihrem feuervergoldeten Mauerkranz und seinen zwölf goldenen Toren, sinnbildlich das „Himmlische Jerusalem“ dar. Spätestens am Festtag „Heilige Drei Könige“ wird uns allen die Bedeutung von Gold sinnbildhaft vor Augen geführt. An diesem Tag bringen die Heiligen Drei Könige ihre Gaben in prunkvollen, goldenen Gefäßen vor das Jesuskind.
Ort der Besinnlichkeit
Eine Frage gegen Ende des Werkstattbesuchs: Wie wird Bernhard Schmitt sein Rentnerdasein gestalten? „Zunächst mit Arbeit“, sagt er schmunzelnd. Bereits im kommenden Frühjahr werde er als Restaurator in eigener Sache gefordert, und sein Wohnhaus aus dem 16. Jahrhundert, wieder auf Vordermann bringen. Ob er noch einmal ein bisschen vergolden und restaurieren wolle? „Mal schauen, eigentlich nicht.“ Was aber feststeht: „Ich will ein wenig Deutschland erkunden, Burgen und Schlösser besuchen, und mich am Leben erfreuen!“
Vor allem liegt Bernhard Schmitt die sinnvolle Nachnutzung seiner alten Wirkungsstätte am Herzen. Ideal wäre es, lässt der 72-Jährige durchblicken, wenn die Kirche als Besitzerin des Gebäudes, den wohl einmaligen Charakter der alten Werkstatt erhalten könnte. Dann hätten auch die liebevoll von Schmitt mit altem Kinderspielzeug, Weihnachts- und Osterschmuck dekorierten Kellerfenster eine Zukunft. Es würde viele Menschen freuen: Die Fenster sind einfach Kult. Ein Ort der Besinnlichkeit wie dieser finde sich kaum noch, lobten Schmitt Passanten wie auch Kunden.
Matthias Risser