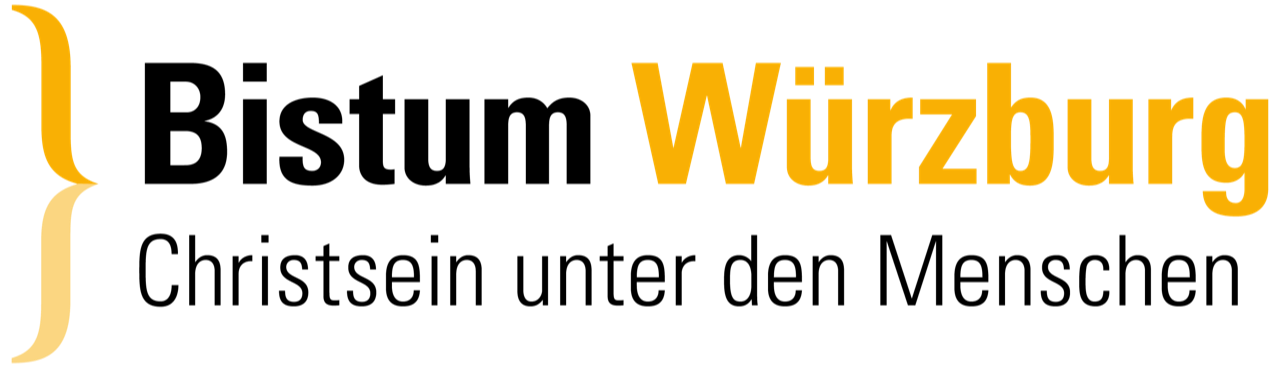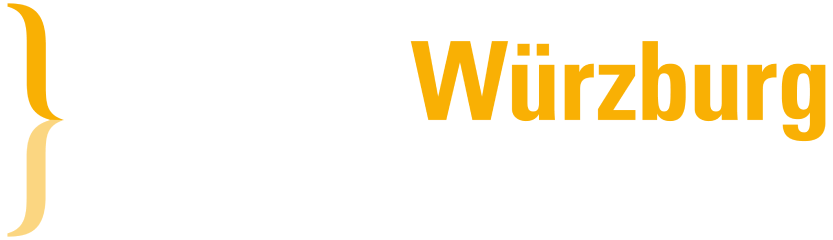Würzburg (POW) Plätzchen backen in der Vorweihnachtszeit, jeden Sonntag eine weitere Kerze anzünden und Geschenke auspacken unter dem Christbaum: Für viele Menschen gehören diese Elemente fest zur Weihnachtszeit dazu. Doch warum feiern wir Weihnachten heute, wie wir es tun? Professor Dr. Klaus Reder beschäftigt sich als Bezirksheimatpfleger intensiv mit Kulturen, Bräuchen und Traditionen in Unterfranken. Er weiß, wie vor 100 Jahren gefeiert wurde, wie sich Merkmale an Festen ändern und welche Strukturen wohl gleich bleiben werden – auch in Zeiten von hohen Kirchenaustritten.
POW: Herr Professor Dr. Reder, vor Weihnachten öffnen wir Adventskalendertürchen, stellen Weihnachtsbäume auf und backen Plätzchen. Wie entstehen solche Weihnachtstraditionen?
Bezirksheimatpfleger Professor Dr. Klaus Reder: Meiner Meinung nach sind es oft einfache Erklärungen. Einer fängt an, anderen gefällt es, und dann wird es zum Massenphänomen. So entwickelt sich das. Um jedes Fest, ob christlich oder nicht, haben sich Bräuche entwickelt. Sie regeln, wann und wie gefeiert wird. Die Aufgabe von Bräuchen ist es, das Leben zu strukturieren und Gemeinschaft zu stiften. Den Weihnachtsbräuchen liegt dabei meist der Gedanke zugrunde, dass Licht ins Dunkel kommt.
POW: Wie verändern sich Weihnachtstraditionen im Laufe der Zeit?
Reder: Weihnachtstraditionen ändern sich mit der Veränderung der Lebensrealitäten. Früher waren die Menschen ärmer und die Weihnachtsfeste reduzierter. Ebenso ändert sich die Welt der Arbeit und der Familien. Weihnachten als Familienfest in Patchworkfamilien zum Beispiel ist ein riesiger organisatorischer Aufwand. Gleichzeitig geht die christliche Kultur immer mehr zurück und macht dem Kommerz Platz. Bräuche können aber auch wandern. Der Adventskranz beispielsweise kommt ursprünglich aus dem Protestantismus. Johann Hinrich Wichern hat ihn 1839 im Rauhen Haus in Hamburg erfunden. Von dort hat sich der Brauch regional und überkonfessionell verbreitet. Heute würde niemand mehr davon sprechen, dass das ein typisch protestantischer Brauch ist.
POW: Werden vermehrte Kirchenaustritte die Art, wie wir Weihnachten feiern, weiter verändern?
Reder: Ich denke nicht. An Weihnachten sind die Kirchen ja voll. In den Gottesdienst zu gehen, gehört für viele weiterhin zu Weihnachten dazu. Und auch Elemente wie die Krippe finden sich weiterhin in fast allen Haushalten.
POW: Gibt es Weihnachtstraditionen, die speziell für Unterfranken typisch sind?
Reder: Eigentlich nicht. Die meisten Bräuche finden sich deutschland- und weltweit mit leichten Abwandlungen. Eventuell gibt es bestimmte Deko am Weihnachtsbaum, die typisch für Unterfranken ist – so wie der Rauschgoldengel in Nürnberg. Aber auch der ist inzwischen überall verbreitet.
POW: Dann einmal ganz konkret: Warum öffnen wir Türchen am Adventskalender?
Reder: Der Advent ist die Zeit der Erwartung. Durch die 24 Türchen wird die Zeit des Wartens symbolisiert. Zu Beginn waren es ganz einfache Pappkalender, zum Teil im Postkartenformat, bei denen man Türchen aufgemacht hat. Heute gibt es Bier-Adventskalender, solche mit Kosmetika und Tee auf dem Markt. So hat sich dieser Brauch verändert. Aber die Grundstruktur, das Warten auf das Christkind, die ist gleich geblieben.
POW: Und woher kommt die Tradition, Weihnachtsbäume aufzustellen?
Reder: Einen Baum oder etwas Grünes ins Haus zu stellen, das gibt es in vielen Kulturen. Grün ist immer ein Zeichen für das Leben. Die Christbäume, wie wir sie heute aus den meisten Wohnzimmern kennen, haben sich als Brauch im 19. Jahrhundert flächendeckend durchgesetzt. Mittlerweile kann man auch auf Plastikbäume und solche im Topf zurückgreifen. Geändert hat sich auch die Verweildauer der Bäume: Zu meiner Jugend stand der Christbaum bis Maria Lichtmess am 2. Februar. Heute wird er spätestens zu Heilig Drei König entsorgt.
POW: Warum backen wir Plätzchen?
Reder: Hier gibt es wieder den Bezug zum bäuerlichen Leben. Geld für Einkäufe war nicht ausreichend vorhanden. Daher hat man, um bestimmte Anlässe zu feiern, Gebäck aus bestimmten Zutaten und in bestimmten Formen gebacken: Zu Fasching Krapfen, zu Kirchweih Kirchweihküchle, und zu Weihnachten eben Lebkuchen, Plätzchen und Stollen.
POW: Zuletzt: Haben Sie persönlich eine Lieblingstradition?
Reder: Ich komme aus einem kleinen Dorf. Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass man an Weihnachten niemanden vergisst. Als Kinder haben wir bei Alleinstehenden Christstollen und Plätzchen vorbeigebracht. Diesen Gedanke verfolge ich heute noch und mache an Heiligabend, neben der Feier in der Kernfamilie, beispielsweise Besuche im Altenheim. Das ist für mich Weihnachten. Und das ist mir die schönste Tradition, die mir das Christentum mit auf den Weg gegeben hat: dass Geben seliger ist als Nehmen.
Interview: Christina Denk (POW)
(4923/1352; E-Mail voraus)
Hinweis für Redaktionen: Foto abrufbar im Internet