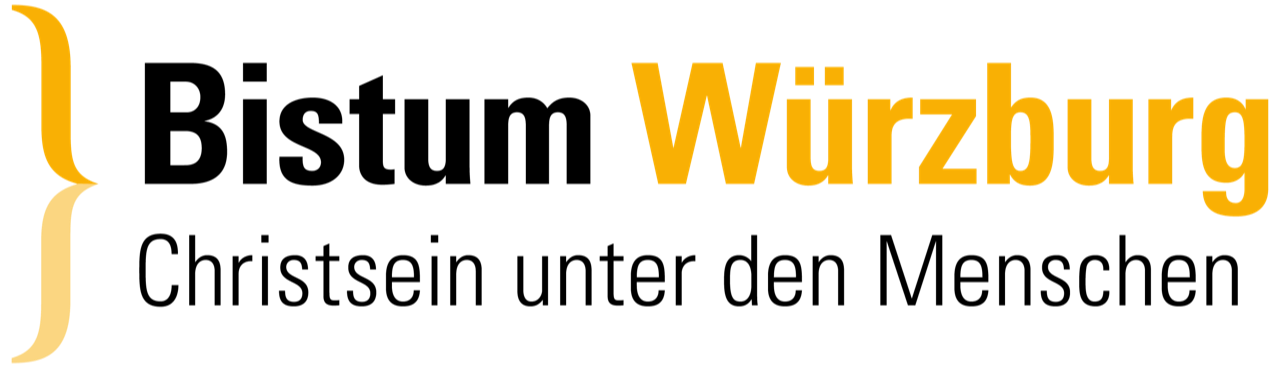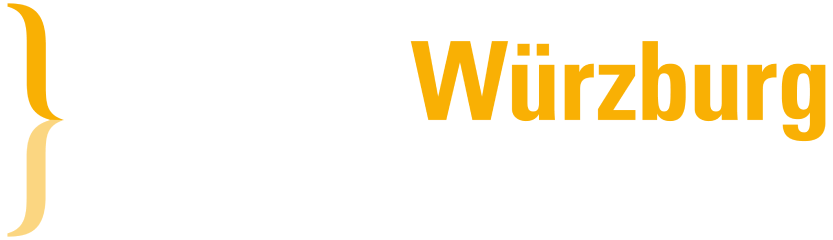Der Studien- und Konferenzteil der Tagung machte deutlich: Landauf, landab zeigt sich in der Arbeitswelt eine Spirale nach unten: Bereits sicher geglaubte Standards für die Beschäftigten würden infrage gestellt und eine Nivellierung nach unten in Gang gesetzt. Nach Ansicht der Arbeiter- und Betriebsseelsorger führt die rein marktwirtschaftliche Bewertung der Arbeit zu menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und ist daher für die zunehmende Verarmung der Gesellschaft verantwortlich.
Dr. Thorsten Meireis von der Universität Münster zog das für die Tagungsteilnehmer überraschende Resümee, dass aus der Bibel keine absolut gültigen Grundlagen für die Definition von „guter Arbeit“ abgeleitet werden können. Ihre Fragestellung und ihr Verständnis von Arbeit unterscheide sich dafür zu deutlich von dem der Gegenwart. Meireis betonte, dass derartige Kriterien für „gute Arbeit“ immer wieder neu im Dialog gefunden werden müssten. Eine wichtige Konsequenz daraus sei für ihn, dass unter den Beteiligten ein solcher Austausch immer wieder neu ermöglicht werden müsse. So sollte eine Grundlage geschaffen werden, aus der sich die Konsequenzen für das Handeln der Kirche in diesem Bereich ableiteten.
Aus Sicht der Katholischen Soziallehre entwickelte Paul Schobel, Leiter der Stuttgarter Betriebsseelsorge, seine Thesen zu „guter Arbeit“ und stellte fest, dass ausgehend von der Schöpfung der Mensch von Gott beauftragt ist, seine Schöpfung zu bewahren und zu bebauen, ja er selbst als schöpferisch Tätiger seine Gottesebenbildlichkeit verwirklicht. Die Sabbatheiligung stellt für Schobel einen wichtigen Anker dar, der dem wirtschaftlichen Ehrgeiz eine Grenze setze und als Kulturleistung einen Kontrapunkt zur täglichen Arbeit darstelle: Gute Arbeit brauche eine Begrenzung, brauche Ruhezeiten und Zeiten des gemeinsamen Miteinanders jenseits von Markt, Wirtschaft und Gewinn. „Für uns ist Jesus der Zugang zum Thema ‚Gute Arbeit’. Er war selbst als Sohn des Zimmermanns Josef handwerklich tätig. Seine Gleichnisse vom Reich Gottes sind Bilder aus seiner Erfahrungswelt in der Arbeit“, erklärte Schobel.
Sie machten deutlich, dass Arbeit effizientes und zielgerichtetes Tun des Menschen sei und eben mehr sei als nur eine Beschäftigung. Die Katholische Soziallehre, sagte Schobel, stelle klar, dass Arbeit keine Ware sei, sondern subjektiven und personalen Charakter habe: Es seien immer Menschen, die arbeiteten und die mit ihrer Arbeit bestimmte Ziele verfolgten, sich selbst verwirklichen wollten und schöpferisch ihre Berufung verwirklichten. Der Vorrang der Arbeit vor dem Kapital und der moralische Rechtsanspruch auf Arbeit waren weitere Punkte in seinen Ausführungen, die in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskussion seiner Meinung nach vollkommen ausgeblendet werden.
Mit „Guter Arbeit“ seien auch die verschiedenen Rechte der arbeitenden Menschen verbunden, die von den Päpsten in den vergangenen 100 Jahren immer wieder eingefordert wurden: Versammlungs- und Koalitionsrecht, sowie das Recht auf Streik, das als letztes Mittel zur Durchsetzung legitimer Rechte begriffen werde. Mitbestimmung und Teilhabe am Unternehmensgewinn seien weitere katholische Positionen, die zur Zeit weit von einer Verwirklichung entfernt seien. Gegen den vorherrschenden neoliberalen Zeitgeist, der alles dem Markt überlässt, gelte es sich für gute Arbeit und gerechte Arbeitsbedingungen stark zu machen. „Arbeit ist Menschenrecht“, betonte Schobel.
Als Vertreter des Bischofs Dr. Friedhelm Hofmann dankte Generalvikar Dr. Karl Hillenbrand den Frauen und Männern in der Betriebsseelsorge und Arbeiterpastoral bei einem gemeinsamen Gottesdienst für ihren Einsatz: „Ihr Dienst ist ein wichtiges kirchliches Engagement an der Seite der Menschen in diesem beherrschenden Bereich unseres Daseins“, sagte Hillenbrand.
(2406/0868; E-Mail voraus)