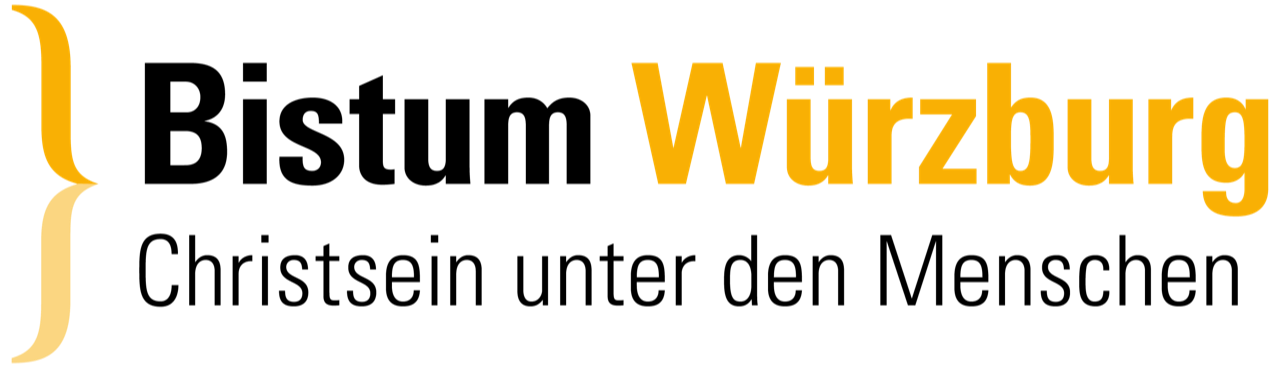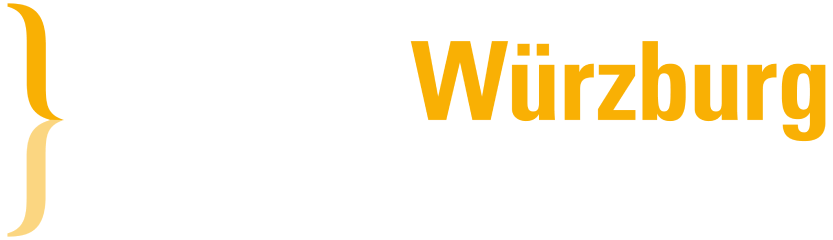Maiandacht im Gefängnis
Im Mai 1944 kam es zu ganz besonderen Maiandachten. Prinz Heinrich Schwarzberg hat sie miterlebt. Er war zwei Monate lang Zellengenosse des Tiroler Jesuiten Johann Schwinghackl, eines Todeskandidaten. Den sichern Tod vor Augen hielt der Pater täglich in der Zelle eine Maiandacht. Prinz Heinrich war der einzige Mitfeiernde. Er berichtet: Es waren „die eigenartigsten Maiandachten, die ich jemals mitgemacht habe, mit Diskussion!“1 In einer menschlich gesehen hoffnungslosen Situation vertraute sich der Pater der Gottesmutter an; überdies sprach er mit seinem Zellengefährten über das, was ihn bewegte. Er wollte ihn teilhaben lassen an der Hilfe, die er empfing. An der Hand Mariens begab er sich auf den Weg der Hoffnung, den sie gegangen ist, und tat zugleich alles, seinen Leidensgenossen auf diesen Weg mitzunehmen. Dieser bezeugt: Der Pater war „ständig in fröhlicher Stimmung … am meisten aber half er durch das Beispiel seiner Gottergebenheit.“2 Beides: Die innere Freude und das Ja zum Willen Gottes zeigen, dass ihm in der Tat ein Leben in der Hoffnung geschenkt wurde. Für ihn traf zu, was Paulus von Abraham berichtet: „Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt“ (Röm 4,18). Genau das gilt in höchstem Maß von der Mutter des Herrn. Im Magnifikat klingt das an, wenn es das Erbarmen Gottes preist, das er Abraham verheißen hat (Lk 1,55).
Was wir eben im Evangelium gehört haben kann uns helfen, dass wir mit ihr den Weg der Hoffnung gehen und so eine Hoffnung finden, die durch nichts zerstört werden kann, die niemand uns nehmen kann.
Maria in Hoffnung
Maria ist auf dem Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth in bester Hoffnung. Kurz zuvor hat sie das Unglaubliche erfahren, das Gott mit ihr vor hat. Der Engel Gabriel hat ihr verkündet, dass sie Mutter des göttlichen Sohnes werden soll. Zurecht hat sie gefragt: „Wie soll das geschehen?“ (Lk 1,34). Darauf sagt der Engel: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden“ (Lk 1,35). Von Gott begnadet spricht Maria ihr Jawort: „Mir geschehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1,38). Im „Engel des Herrn“ beten wir: „Und sie empfing vom Heiligen Geist“. Maria wird Mutter Gottes. Sie ist in einzigartiger Weise in Hoffnung. In ihrem Schoß lebt der Erlöser und wächst so in unsere Welt hinein.
Damals erlebt die Mutter des Herrn das ganz Besondere der christlichen Hoffung. Allen Christgläubigen dürfen in Wahrheit das Beste hoffen. Das ist mehr als dies oder jenes Gut, das wir gerne haben und vielleicht sogar erhalten mögen. Das höchste Gut, das wir empfangen können und sollen ist: „Christus in uns, er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit“ (Kol 1,27). Entsprechend ruft uns der erste Petrusbrief zu: „Haltet Christus, den Herrn, in eurem Herzen heilig“ (1 Petr 3,15). Der Mensch gewordene Gottessohn will uns nicht nur von oben oder von außen her seine Hilfe schenken. Er will in uns wohnen und wirken. Er will uns näher sein als wir uns selber nah sein können; er will uns mehr schenken als irgendjemand uns schenken kann. Er will höchstpersönlich in uns sein, wir dürfen zugleich in ihm sein. Eine dauernde Heilige Kommunion will er mit uns feiern. Wir haben allen Anlass, mit Maria zu singen: „Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt in Gott, meinem Retter“ (Lk 1,48). Zugleich sind wir berufen, diese wunderbare Wahrheit weiterzugeben. Im Anschluss an den Appell, Christus den Herrn, in unserem Herzen heilig zu halten, werden wir aufgefordert, jedem Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die uns erfüllt (1 Petr 3,15). Pater Schwinghackl hat das sogar im Gefängnis fertiggebracht, als er im Anschluss an die tägliche Maiandacht mit seinem Leidensgefährten über das sprach, was er im Gebet zum Ausdruck gebracht hatte. Die Mutter des Herrn praktiziert es im Magnifikat. In immer neuen Wendungen preist sie das Wirken des Herrn in ihr und in allen, die in fürchten, denn über sie alle erbarmt er sich „von Geschlecht zu Geschlecht“ (Lk 1,50).
Bevor das geschieht, hat unsere liebe Frau sich auf den Weg gemacht.
Maria auf dem Weg zum Nächsten
Sie hat erfahren, dass ihre Verwandte Elisabet noch im hohen Alter einen Sohn empfangen hat. Sofort ist sie bereit, ihr beizustehen. Natürlich hätte sie sich sagen können: „Ich bin durch den Heiligen Geist Mutter Gottes geworden. Das ist fortan meine einzigartige Aufgabe. Auf sie muss ich mich voll konzentrieren. Meine ganze Kraft und auch meine ganze Zeit muss meinem Sohn gehören. Die Hilfe, die Elisabeth braucht, können hundert andere auch leisten. Ich muss allein meinem Sohn helfen.“ Sie hätte allen Grund gehabt, das zu sagen und entsprechend zu handeln. Das Evangelium berichtet uns Besseres: „Maria machte sich auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa“ (Lk 1,39). Nichts hält sie davon ab, sogleich die Hilfe zu leisten, die ihr möglich ist. Dabei geschieht mehr als was eine geschickte junge Frau für eine andere tun kann, die ein Kind erwartet. Mit Maria kommt ihr Sohn zu Elisabet und zugleich zu deren Sohn. Der Evangelist bringt zum Ausdruck, dass Elisabet und Johannes etwas von diesem wunderbaren Geschehen erfahren dürfen. Der kleine Johannes wird von Freude bewegt und seine Mutter spricht voller Begeisterung von diesem Ereignis. Sie preist ihre Helferin und die Frucht ihres Leibes. Sie fragt: „Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ (Lk 1,42 f.). Elisabet ist es gegeben, auch das zur Sprache zu bringen, was am Anfang der Menschwerdung des Gottessohnes steht: „Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ“ (Lk 1,45). Das liebende Ja, das Gott zu Maria spricht, die in diesem Augenblick alle Menschen vertritt, wird von ihr mit dem Ja des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe beantwortet. Mit diesem Ja wird der neue Bund besiegelt, den Gott mit den Menschen schließen will.
Auf ihrem Weg zu Elisabet tut Maria, was wesentlich zur christlichen Hoffnung gehört: Der Christ darf nicht nur das Beste hoffen, er ist zugleich aufgefordert, das Beste zu tun. Christliche Hoffnung ist tätige Hoffnung. Eine Formulierung von Ernst Bloch aufnehmend können wir sagen, der Christ ist aufgerufen, sich tätig ins Werdende hineinzuwerfen, zu dem man selber gehört3. Wie die Diener bei der Hochzeit zu Kana weist Maria auch uns an: „Was er euch sagt, das tut“ (Joh 2,5). Deshalb darf sich die Marienverehrung nicht auf schöne Gefühle und fromme Gedanken beschränken; zu ihr gehören immer auch Taten, Taten der Liebe. Mit Nachdruck haben die Konzilsväter betont, „dass die wahre Andacht weder in unfruchtbarem und vorübergehendem Gefühl noch in irgendwelcher Leichtgläubigkeit besteht, sondern aus dem wahren Glauben hervorgeht, durch den wir zur Anerkennung der Erhabenheit der Gottesmutter geführt und zur kindlichen Liebe zu unserer Mutter und zur Nachahmung ihrer Tugenden angetrieben werden.“4 Wie es zum rechten Glauben gehört, dass er in der Liebe wirksam wird (Gal 5,6), so zeigt sich Hoffnung in der Liebe, so muss sich die Hoffnung in der Liebe auswirken. Der Weg der Hoffnung ist ein Weg, der zum Nächsten führt. Dort endet er nicht. Er führt darüber hinaus zum Höchsten, zum Allerhöchsten; er führt zum dreieinen Gott.
Maria auf dem Weg zum Höchsten
Pater Schwinghackl wusste um diese letzte Zielsetzung. Das machte es möglich, dass er selbst im Angesicht des Todes die Freude nicht verlor. Unmittelbar vor seiner Hinrichtung schreibt er mit gefesselten Händen an seine Verwandten: „Nun nehme ich Abschied von euch. Oft bin ich von daheim und von euch weggegangen. Nie war ich so leicht und beglückt wie diesmal, obwohl ich euch alle mit tiefer Liebe im Herzen trage. Wie es mir geht, wollt ihr wissen. Wenn ich sage: gut, ich bin glücklich, so ist das viel zu wenig. Ich bin selig!“5 „So warte ich auf das Letzte: das Blutopfer … Der Kelch ist voll, aber das ist das Schöne, so voll der Kelch ist, so übergroß und lieblich ist die göttliche Gnade … Im Himmel, in der Heimat sehen wir uns wieder.“6
Die Gottesmutter ist auf dem Weg dorthin uns voraufgegangen. Bei seiner Mutter hat unser Erlöser als erstem Menschen wahrgemacht, was er seinen Jüngern im Abendmahlssaal versprochen hat: „Wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein“ (Joh 12,26). Im Blick auf seine geliebte Tochter erfüllt der Vater bei ihr als erster die Bitte des hohepriesterlichen Gebetes: „Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt“ (Joh 17,24). Die geliebte Tochter des Vaters, die Mutter des Sohnes und die Braut des Heiligen Geistes wurde mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen. Ihr Weg der Hoffnung führt mitten hinein in das Geheimnis des ewigen Lebens. Mit dem dreieinen Gott in einzigartiger Weise vereint kann und will sie uns in einzigartiger Weise helfen. Sie steht uns bei, dass wir den Weg der Hoffnung, den sie gegangen ist, nicht nur erkennen, sondern frohen Mutes beschreiten.
Bitten wir sie: „Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere Mutter. Wie kein Mensch sonst hast du in Hoffnung gelebt. Durch dein Leben und Wirken hast du uns gezeigt, dass wir das Beste hoffen dürfen und zugleich aufgerufen sind, das Beste zu tun. Mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen kannst du die Erfüllung der Hoffnung voller Freude erleben. Erbitte uns die Gnade, dass wir dir auf dem Weg der Hoffnung folgen, bis wir mit dir und allen Erlösten für immer bei deinem Sohn sind, der unsere Hoffnung ist.“
Amen.